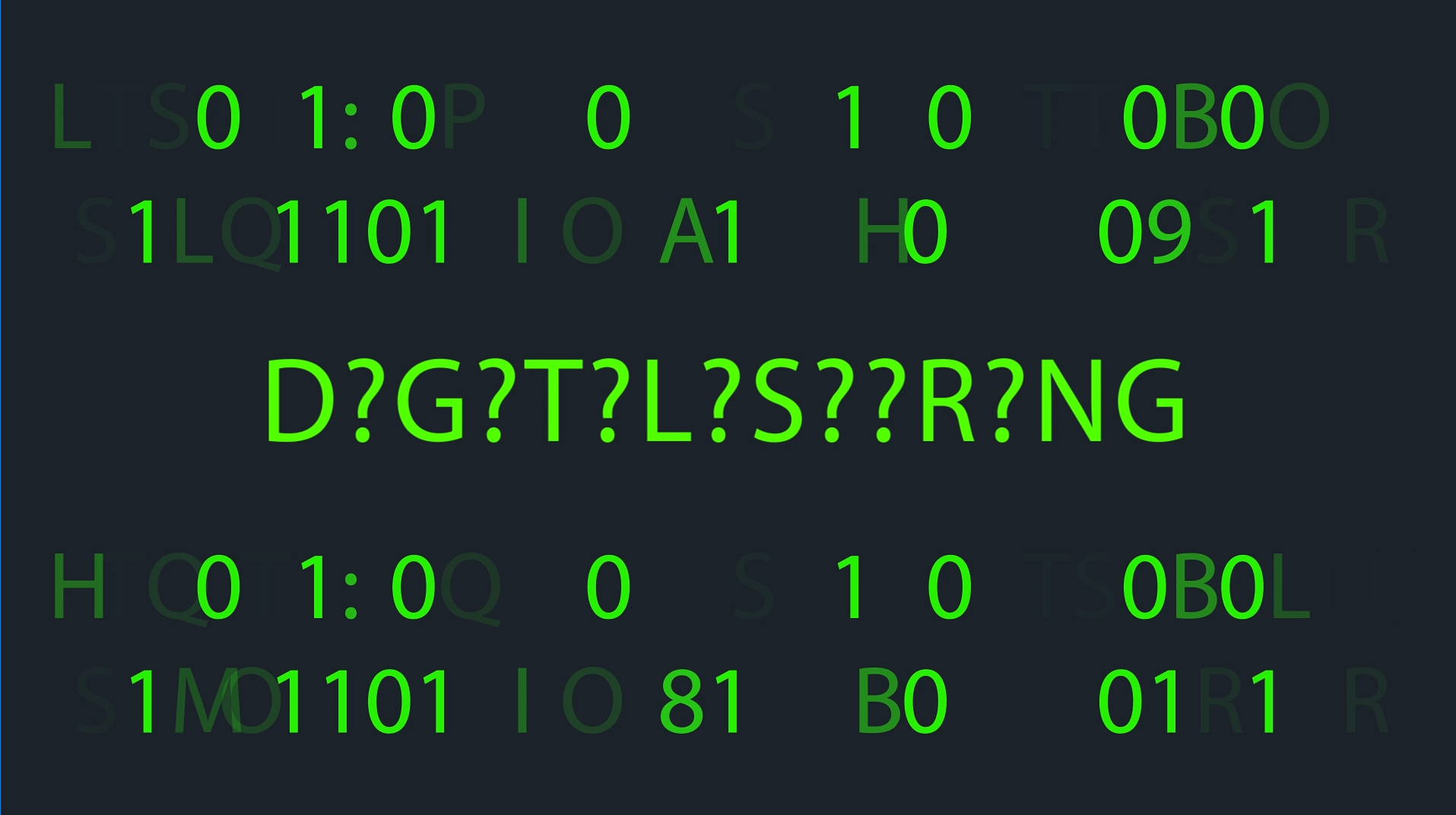
The video series is part of a MOOC, collaboratively developed across institutional borders with contributions from ETH, ZHdK, and UZH.
Digital Skills for Teachers
Project abstract
ETH took the lead in producing the introductory chapter for the MOOC, which consists of eight videos. The video series offers an in-depth exploration of the intricate world of higher education videos, beginning with a primarily theoretical approach. Central to this exploration is the inquiry into the functioning of audio-visual perception and how videos can be utilized in a scientifically rigorous and pedagogically meaningful manner, effectively enhancing contemporary university teaching. Throughout the series, we present the distinctive characteristics of videos and provide illuminating examples of the codes employed in audio-visual knowledge transfer. What better medium to convey this information than video itself? The subsequent chapters aim to acquaint viewers with video as a language for scientific communication and inspire them to critically and reflectively employ this medium in the context of academic instruction.
The videos are available on the MOOC platform and can also be accessed through our LET ETH YouTube channel, expanding their reach to a wider audience.
1.2 Digitalisierung und Hochschulbildung
Im ersten Subkapitel wird ein multiperspektivischer Blick auf Digitalisierung geworfen sowie die Wirkung dieser globalen Entwicklung innerhalb der Hochschulbildung beleuchtet. Dabei werden zentrale Frage zum Verhältnis Digitalisierung und Hochschulbildung präsentiert, konstruktive Ansätze zum Umgang mit der Digitalisierung in der Hochschulbildung thematisiert sowie Mythen rund um die Digitalisierung in der Hochschuldbildung dekonstruiert. Ziel ist es, Digitalisierung als Einladung zu verstehen, kritisch darüber nachzudenken, wer wir sind und wie wir die Welt sehen.
2.1 Wissenschaftliche Videos - Kritik und Potenzial
Wissenschaftliche Videos faszinieren immer wieder von Neuem, sind aber nichts Neues. Im folgenden Kapitel werfen wir einen vertieften Blick in die historischen Wurzeln von Wissenschaft und Film. Neben den Potentialen des Bewegtbild-Mediums werden gleichzeitig jedoch auch die Kritikpunkte angesprochen, welche bereits seit den frühen Anfängen des Wissenschaftsfilms existieren und auch heute immer wieder akademischen Diskurs stehen. Der Diskurs von Wissenschaft, Lehre und Film, so zeigen wir in diesem Kapitel, ist lebhaft.
2.5 Mediendidaktische Aspekte
Dieses Subkapitel fokussiert mediendidaktische Perspektiven in Zusammenhang mit Videos in der Hochschullehre. Dabei geht es in der Mediendidaktik um die Frage nach einer möglichst lernförderlichen Integration von digitalen Medien in den Unterricht einer Lehrveranstaltung sowie um den Aspekt der Partizipation und Kooperation im Rahmen von mediengestützten Lernprozessen. Gemäss dem Ansatz der partizipativen Mediendidaktik soll das digitale Lernmedium nicht etwas Trennendes, sondern etwas Verbindendes sein – sowohl zwischen den Lehrpersonen und den Studierenden als auch zwischen den Studierenden. Ein reflektierter, kompetenter sowie zielgerechter Einsatz von digitalen Medien in der Hochschullehre versteht das Medium Video somit als eine gemeinsame Sprache, mit der sich die Teilnehmenden mit einem Thema oder über einen Sachverhalt auseinandersetzen und austauschen können.
1.4 COVID-19 und die Hochschulen
Covid-19 hat den Alltag aller Menschen fundamental verändert. Davon betroffen ist auch die Hochschullehre, die sich im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie einer kurzfristigen 'Zwangsdigitalisierung' unterziehen musste – was zwar kritisch, aber durchaus als Chance gesehen werden darf: Denn obwohl es nicht das Ziel ist, in der Post-COVID Ära im ‘online-only Format’ weiter zu unterrichten, so bieten die aktuellen Umstände viel Raum für Erfahrung und Experimente, wie längerfristig Online- und Präsenzlehre an Hochschulen gestaltet und kombiniert werden kann.
2.3 Digitaler Vortrag als Performance
Im Hochschulkontext wird heute oft der Begriff "Talking Heads" verwendet. Die Definition eines Talking Heads wird im Filmlexikon der Universität Kiel sehr kritisch betrachtet und lautet wie folgt: "Eher ironische Bezeichnung für die Dominanz der vor allem in Fernsehdokumentationen auftretenden »sprechenden Köpfe« von Interviewten, die meist in halbnaher bis naher Einstellungsgröße aufgenommen werden (sei es, vor einem szenisch-sprechenden Hintergrund – Bücherwände für Geisteswissenschaftler, Labore für Chemiker, Archivregale für Historiker etc. –, sei es vor einer neutralisierten, meist monochrom schwarzen Fläche). Die Inszenierung wirkt statisch, ist visuell wenig ansprechend, verlagert die Aufmerksamkeit ganz auf das Gesprochene."
2.6 Social Video Learning
Eine der grundlegenden Gefahren beim Lernen mit Videos stellt eine mögliche Konsumhaltung der Betrachterinnen und Betrachter. Dabei ist Lernen gemäss konstruktivistischer Lerntheorie ein aktiver und konstruktiver, aber auch ein sozialer Prozess. Das aktive Lernen alleine und in Gruppen sowie Interaktion und unterschiedliche Formen des Austausches zwischen den Studierenden sind daher elementare Bestandteile einer guten Hochschullehre.
Diese didaktischen Maxime lassen sich auch beim Einsatz von Videos in der Hochschullehre umsetzen: Mit modernen Softwarelösungen lassen sich unterschiedliche interaktive Funktionalitäten zu den Sequenzen im Video ergänzen. Diese reichen von einer Kommentarfunktion, die durch das Antworten auf Kommentare auch für Diskussionen genutzt werden kann, der Einbindung von unterschiedlichen Fragetypen (wie z.B.: Multiple Choice, offene Fragen, Lückentexte, Drag&Drop etc.) sowie die Erstellung von Auswahloptionen für den weiteren Ablauf des Videos (adaptives Lernen) etc. Das Video kann mithilfe einer entsprechenden Software an jeder beliebigen Stelle angehalten und die interaktiven Funktionalitäten eingefügt werden.
Durch interaktive Videos wird somit das Spektrum der didaktisch-methodischen Möglichkeiten von Lernvideos erheblich erweitert und die Lernenden bzw. Studierenden aus der passiven Konsumhaltung in eine aktive Rolle beim Lernprozess gebracht. Wie ein sinnvoller Einsatz in der Hochschullehre aussehen kann, wird in diesem Kapitel und dem dazugehörigen Video thematisiert.
2.4 Lernpsychologischer Blickwinkel
Aus lernpsychologischer Perspektive sind beim Lernen mit Videos vor allem folgende Aspekte lernförderlich: Multimodalität und Multicodierung.
Mit Multimodalität ist gemeint, dass bei Filmen und Videos durch die Verbindung von Bewegtbildern und Ton zeitgleich unterschiedliche Sinneskanäle angesprochen werden. Da die Informationsaufnahme beim Menschen über zwei voneinander getrennte Sinneskanäle (visuell und akustisch) erfolgt, können die Sinneswahrnehmungen entweder im entsprechenden Kanal verarbeitet oder durch kognitive Prozesse in den jeweils anderen Kanal überführt werden. Durch die synchrone auditive und visuelle Wissensvermittlung wird das Gedächtnis optimal bei der Informationsaufnahme unterstützt, indem der visuelle Sinneskanal entlastet wird. Durch die synchrone Verarbeitung beider Sinneskanäle können komplexe Zusammenhänge in multimedialer Aufbereitung besser nachvollzogen und erlernt werden.
Multicodierung betont demgegenüber die Möglichkeit, ein Thema oder Inhalt durch unterschiedliche Darstellungsformen aufzubereiten. So lassen sich mit Videos unterschiedliche Aspekte eines Themas betonen und hervorheben, unterschiedliche Blinkwinkel und Perspektiven können umgesetzt und prozesshafte Abläufe und Wechselwirkungen können in ihrer Gesamtheit dargestellt werden.
Darauf aufbauend werden in diesem Kapitel drei grundlegende lernpsychologische Theorien eingeführt, die in Zusammenhang mit Videos als Bildungsmedien in der Hochschullehre von Bedeutung sind:
- die Dual Coding Theory von Paivio
- die Cognitive Load Theory von Sweller
- die Cognitive Theory of Multimedia
Learning von Mayer
1.3 Lehr-/Lernkulturen in einer globalisierten, digitalen Welt
Die Digitalisierung stellt einerseits eine Herausforderung für die Hochschulen dar, kann aber andererseits auch als Chance gesehen werden, um die traditionelle Lehr- und Lernkultur an Hochschulen weiterzuentwickeln. Aber inwiefern ist die digitale Transformation der Hochschullehre tatsächlich förderlich für eine «neue Lehr- und Lernkultur»? Dieses Kapitel thematisiert Erwartungen und Enttäuschungen, welche die Digitalisierung im Kontext der Hochschulbildung mit sich brachte und bringt sowie inwiefern in Zusammenhang damit ein verantwortungsvoller sowie kritischer Umgang mit digitalen Medien erlernt und gepflegt werden muss.
2.2 Zur Audiovisuellen Wahrnehmung von Videos
Spätestens als McGurk & McDonald (1976) die crossmodale Abhängigkeit einer audiovisuellen Sprachwahrnehmung effektvoll aufzeigten, wurde klar, dass das Zusammenspiel von Sehen und Hören im 'Bewegtbild-Medium Film' komplexen, unbewussten Verarbeitungsprozessen unterliegt. Bild und Ton bedingen sich im audiovisuellen Bewegtbild gegenseitig. Das, was gesehen wird, beeinflusst das, was gehört wird und vice versa.
Doch wie genau funktioniert dieses Verhältnis von Sehen und Hören in Bewegtbildern? Das folgende Video begreift Film als audiovisuelle Illusion und führt die einzelnen filmischen Parameter vor. Anhand von dieser Einführung in die Wissenschaft des Films wird hervorgehoben, wie audiovisuelle Wahrnehmung funktioniert sowie wie diese zugunsten einer optimalen Wissensvermittlung manipuliert werden kann.
MOOC Implementation Overview
The MOOC “Videos in der Hochschullehre” can be openly and self-paced accessed via swissmooc
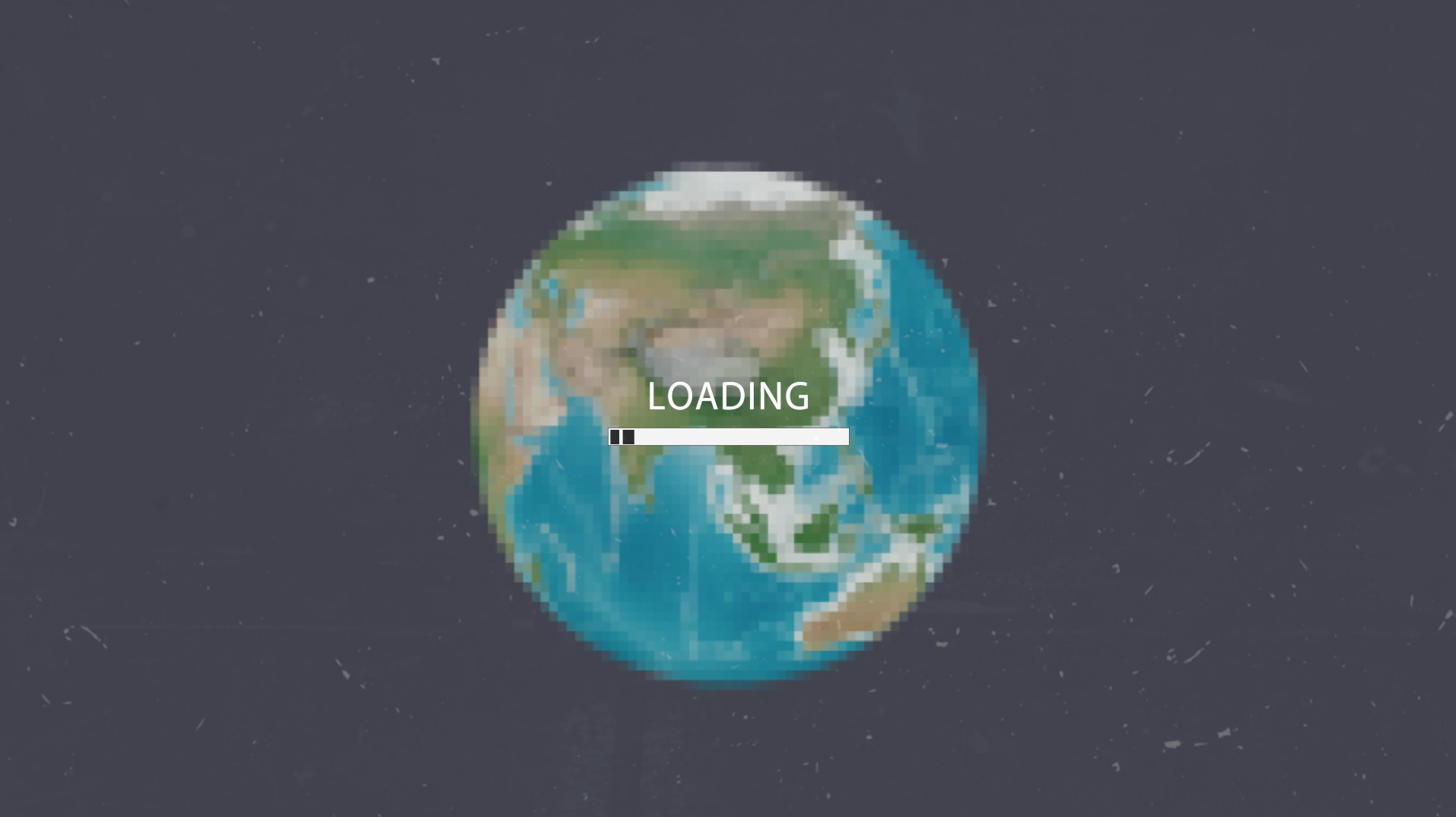
Filmstills from the series
People involved
Project type:
A swissuniversities p-8 project
Educational Content Development and MOOC Implementation:
Dr. Benno Volk, Dr. Jeanine Reutemann
Judith Rehmann M.A.
Content Experts:
Dr. Benno Volk, Prof. Andreas Hebbel-Seeger
Dr. Frank Vohle
Project Lead EduMedia Team:
Dr. Jeanine Reutemann
Dr. Benno Volk
Script Development:
Judith Rehmann M.A.
Dr. Jeanine Reutemann
Dr. Benno Volk
Voice Over:
Birge Tetzner
Camera:
Dr. Jeanine Reutemann
Art, Visual Design and Animation:
Paulina Zybinksa, Chenrui Zhano
Postproduction and Sounddesign:
Dr. Jeanine Reutemann
Backstopping:
Dr. Gerd Kortemeyer
Further information
Target Group:
National teaching faculty for higher education
Implementation:
MOOC, Summer 2022
Products:
8 Videos (5–10 minutes)










